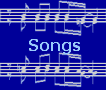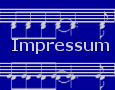|
Ich habe dich so lieb
(Joachim Ringelnatz) |




|
Erscheinungsdaten
„Ich habe dich so lieb“ ist von Ringelnatz 1928 bei Rowohlt (Berlin) erschienen.
Copyright-Hinweis
Der Text des Stückes ist gemeinfrei, da der Textdichter, Joachim Ringelnatz, im Jahre 1934 verstarb.
Die Melodie wie auch das Arrangement sind vom Urheberrecht geschützt, sie stammen von Uli Führe.
Bedeutung
Die sechs Strophen des Gedichts haben kein umfassendes Reimschema, gleiche Länge oder auch nur gleiche Zeilenanzahl. Von den (nicht durchgängigen Zeilen-End-) Reimen abgesehen gibt es nur die Strukturierung durch die Zeilen- und Strophenwechsel, die dieses Gedicht ein Gedicht sein lassen, wie wir es im Schulunterricht kennen gelernt haben. Mit den Worten des großen Wiglaf Droste „Prosa ist horizontal, Lyrik ist vertikal“ müssen wir aber dennoch einsehen, dass es sich eindeutig um ein Gedicht handelt.
Eine grundlegende strukturelle Analyse soll daher ausfallen, allerdings werde ich nach einer Betrachtung von Ringelnatz' Bildsprache auf diesen Punkt zurückkehren und einzelne Punkte herausheben, die mit für die Interpretation des Werkes sinnvoll erscheinen.
Es wäre üblich, das „Ich“ des Gedichts durch die Phrase „das lyrische Ich“ zu umschreiben, weil nicht klar ist, ob Ringelnatz sich tatsächlich selbst gemeint hat oder sich in eine Rolle hineinimaginiert, aus deren Perspektive er dieses Gedicht erzählt. Da mir diese Phrase aber zu gestelzt und allzu sehr nach Deutschklausur klingt, werde ich das lyrische ich im Folgenden als „der Dichter“ benennen und unterstelle, das es sich um eine erzählende Person in Ringelnatz' Geist gehandelt hat, unabhängig davon, ob er sich selbst gemeint hat, oder nicht. Ringelnatz selbst wird erwähnt werden, wenn es geboten scheint, dass er als Dichter, Handwerker an dem Gedicht, diese oder jene Entscheidung getroffen haben könnte und wenn ein Bild unter dem Hintergrund seiner persönlichen Vergangenheit interpretiert werden kann, dies wird dann aber durch die Nennung seines Namens von dem unpersönlichen Dichter kenntlich gemacht werden.
Sofort ins Auge fällt, ist, dass der Dichter allein handelnde Person des Gedichts ist, „Ich“ ist Strophenanfang von vier der sechs Strophen und auch sonst ist der Betrachtungswinkel der aus der Egoperspektive. Eine zweite Person kommt als „Du“ zwar vor, ist aber selbst nicht handelnd sondern allein passiv und den Zuweisungen des Dichters widerspruchsfrei ausgeliefert. Der Leser erfährt nichts über dieses „Du“, nur, was der Dichter ihm oder ihr gegenüber zu sagen hat.
Schauen wir uns im Folgenden die Bilder, die Ringelnatz in seinem Gedicht aneinandereiht, stophenweise näher an.
„Ich habe dich so lieb“. Unschuldig und sanft klingt dieser Satz – viel weniger eine entsprechende Reaktion der Gegenseite fordernd als das deutlich häufiger verwendete „Ich liebe dich!“. Auch steckt viel weniger Rechtfertigung (die sich sonst häufig wiederfindet in dem Satz „Aber ich liebe dich doch“) und viel weniger Männer/Frauen/Beziehnungen, ja Eros, darin. Diesen Satz mag der Dichter zu seiner Geliebten ebenso sprechen wie zu seiner Ehefrau, mit der er gerade goldene Hochzeit feiert, aber gleichzeitig auch zu seinem Kind, Elternteil oder auch guten Freund. Dieser Satz rahmt, alleine stehend, den Rest des Gedichtes ein und bildet gleichzeitig den Titel des Werks – um deutlich zu machen, dass das vorherrschende Thema die Liebe zu genau einem anderen Menschen sein soll, hätte es kaum unsubtiliere Methoden gegeben.
Wenden wir dem weiteren Verlauf der ersten Stophe zu. „Ich würde dir ohne Bedenken eine Kachel aus meinem Ofen schenken“. Schon beginnt Ringelnatz das Feuerwerk an staken Bildern, dass er dem Leser in diesem Gedicht um die Ohren zu feuern gedenkt. Die Kacheln eines Kachelofens haben nur einen Zweck: sich an der Hitze des innenliegenden Brennraumes zu erwärmen und diese Wärme möglichst langanhaltend an den Raum abzugeben. Ein Kachelofen macht es nicht einfach warm – die besonderen Eigenschaften des Schamotts (insbesondere die Frequenz der abgestrahlten Infrarotstrahlung) sorgen dafür, dass die von seinen Kacheln ausgestrahlte Wärme als das Sinnbild für Behegalichkeit stehen kann. Und nicht nur das. Seine Kacheln wärmen auch dann noch den Raum, wenn das Feuer, das in ihm brannte, schon lange erloschen ist. Wie schon in der ersten Zeile haben wir es hier mit einem Bild zu tun, dass nichts mit dem Eros, wohl aber mit langer, treuer, ja beinahe ewiger Liebe zu tun hat. Aber es wird ja nicht allein der Ofen genannt – eine Kachel ist es, die verschenkt wird. Hiermit verliert der eigene Ofen seine Vollständigkeit, büßt etwas von seiner Fähigkeit ein, den Raum behaglich zu gestalten und wird erst wieder komplett sein, wenn die Kachel ihm wieder eingesetzt wurde. Der oder die Beschenklte wird so zu einem wichtigen Faktor darin, dass es dem Schenkenden behaglich zumut ist – ein großer Liebesbeweis, aber auch eine große Verantwortung. Man möchte fast glauben, einen Ring zu verschenken könnte keine größere Geste sein. Und diese Geste entstammt einer tiefen Überzeugung. Nicht überstürzt oder spontan, „sofort“, „jetzt“ oder „schnell“ würde unser Dichter die Ofenkachel verschenken, sondern „ohne Bedenken“, ohne,dass da auch nur ein kleiner Zweifel oder auch nur ein Zögern wäre.
Die zweite Strophe wollen wir von hinten nach vorn ansehen.
„An den Hängen der Eisenbahn leuchtet der Ginster so gut.“ Zum Leuchten muss so eine Pflanze erst einmal in Blüte stehen – die meisten Ginsterarten blühen im Frühsommer, so dass uns Ringelnatz hier ungewollt einen Hinweis auf die Jahreszeitliche Einordnung des Gedichtes gibt. Dafür, dass eine Blüte „leuchtet“ muss außerdem die Sonne scheinen, wir lernen also, dass dieses Bild an einem wunderbar sonnigen Tag im Frühsommer spielt, wahrscheinlich nicht allzu früh oder allzu spät am Tage, so dass das strahlende Gelb der Ginsterblüten im hellen Schein der wärmenden Sonne leuchten kann und nicht vor Morgen- oder Abendrot verstellt wird.
Das Bild selbst ist ein starkes Abschiedsbild, wie es in Vollendung der Farbfilm hervorbringen wird. Der Blick fällt dann auf die gelbleuchtenden, ginsterbewachsenen Hügel links und rechts der Gleise, wenn der Zug, dessen Abfahrt wir im Bild gezeigt bekommen haben, den Bahnsteig lange verlassen hat und die Kamera weiter auf die Ferne gerichtet ist, in der das kleine Rauchfähnchen der Lokomotive gerade hinter einer Biegung verschwunden ist. Im Zusammenklang mit den beiden ersten Zeilen dieser Stophe vermittelt es ein hilflos-trauriges Bild eines zurückgelassenen, der fast apatisch der Lieben hinterhersieht und vielleicht insgeheim die Hoffnung hegt, der Zug möge doch noch umkehren und diesen Abschied ungeschehen machen.
Es gibt aber noch eine weitere Interpretationsmöglichkeit dieses Bildes, was vielleicht wegen der aktiven Rolle, die der Dichter in seinen Zeilen einnimmt, auch eine realistische Einschätzung ist, nämlich, dass nicht der Blick in die Ferne, sondern der aus dem Zugfenster gezeigt wird, leicht schräg nach unten auf den Gleiswall, auf dem, der Geschwindigkeit des Zuges wegen, die einzelnen Ginsterblüten zu einem gelben Band verschwimmen, als hätte jemand die Landschaft in Ölfarbe getaucht.
Eine andere Erklärung für den Blick auf den Ginster liefert natürlich ebenso die angesprochene Traurigkeit. Wenn man den Bewuchs auf den Eisenbahnhängen betrachtet, lenkt man den Blick weg vom sich entfernenden Zug oder vom sich entfernenden Bahnhofe (je nachdem, ob man selbst ´oder die Geliebte wegfährt), es bietet also eine gewissen Ablenkungvon den trüben Gedanken, und gerade eine sonnenbestandene, knallgebe Blütenpracht ist hierfür als nicht vollkommen ungeeignet anzusehen. Allerdings ist es interessant, dass es gerade Ginster ist, den der sich abwendenden Blick einfängt, denn alle Ginsterarten sind mehr oder weniger giftig – je nach der Art, die sich gerade auf diesen konkreten Bahnhängen befindet wird er, egal, welche Pflanzenteile verzehrt werden, Übelkeit, Erbrechen, Krämpfe, Durchfall und vielleicht sogar den Tod verursachen. Der abgewendete Blick ist also gleichsam „vergiftet“ – Trost findet sich in diesem Bild nur vom Anschein her, jede Hoffnung auf eine tiefere Linderung der eigenen Pein wird nur zu einer Verschlimmerung des Leidens führen.
„Ich habe dir nichts getan, nun ist mir traurig zumut“. Zwischen dem Bild er ersten und den noch folgenden Bildern ist es hier erst einmal erfrischend zu nennen, dass der Dichter seinen Gefühlszustand klar und deutlich äußert. Er ist traurig. Da direkt ein starkes Bild des Abschieds folgt, ist anzunehmen, dass er wegen dieses Abschieds traurig ist und durch Voranstellen des klaren Gefühlsausdrucks das folgende Bild entsprechend vorbereiten will. Unverständnis, hilflose Rechtfertigung und anklagende wenn auch aussichtslose Verteidigung gegen eine erlittene Ungerichtigkeit mag die erste Zeile der Strophe sein „Warum tust du mir das an, ich habe dir doch nichts getan“ möchte man diesen Satz weiterspinnen, um dann mit dem Dichter im weiteren Verlauf der Strophe in Trauer und Abschied zu versinken.
Die folgende Strophe führt den Leser von des Dichters aktueller Traurigkeit zu einem traumatischen Ereignis seiner frühen Vergangenheit. Etwas ist „Vorbei“, ja mehr noch „Verjährt“ und dieser Begriff, der der Sprache der Rechtswissenschaften entsdtammt, macht deutlich, dass es sich um eine Schuld handelt, die entweder der Dichter selbst auf sich geladen hat, oder sich jemand ihm gegenüber schuldhaft betragen hat. Verjähren können, nach unserem Rechtsempfinden, sowohl zivil- wie auch starfrechtliche Belange. Bei verjährten Ansprüchen im Zivilrecht wie zum Beispiel dem Anrecht auf Eigentum und Erbrechtsbelange kann dieser Wert nicht mehr eingeklagt werden, im Falle von strafrechtlichen Belangen tritt ein Verfolgungsverbot in Kraft, das dazu führt, dass ein potentieller Täter nicht mehr strafrechtlich verfolgt werden darf, und, sollte er es doch worden sein, kein Prozess gegen ihn eröffnet werden kann beziehungsweise dieser sofort zu beenden ist. Für eine verjährte Tat kann somit keine Strafe verhängt werden.
Der Dichter stellt hier fest, was immer die Tat auch war, und auch, wenn sie verjährt ist, sie wird niemals vergessen werden. Es klingt der bekannte Ausspruch „Vergeben und vergessen“ in diesem „nimmer vergessen“ an, mit der starken Verneinung davor wird diese Zeile zornigen, bald hasserfüllten Anklage an den Täter (oder Selbstanklage), auch wenn die Tat ewig lange her sein möge, würde er dafür beim Dichter keine Vergebung finden. „Ich reise“ fährt er fort – eine kurze Zeile, die für die vorige Strophe vermuten lässt, dass es der Dichter ist, der in diesem Zug sitzt und keine geliebte, weitere Person. Nach der heftigen Ansprache an den Täter zu Beginn der Strophe findet sich hier bald soetwas wie Flucht. Der Dichter hat sich der Situation nicht gestellt, mit dem tiefen Gefühl der Unversöhnlichkeit im Bauch hat er die Situation verlassen, und hier schlägt er die Brücke zu seiner aktuellen Traurigkeit: Wieder ist er verletzt worden, und wieder ist er es, der die Situation ohne Auflösung verlässt.
Die Strophe findet ihr Ende in dem Satz „Alles was lange währt ist leise“. Hier spielt Ringelnatz mit dem Ausspruch „Was lange währt wird endlich gut“ und stellt eben fest, dass das, was lange wärt, vielleicht nicht gut wird, aber eben leise ist. Ob hier eine Implikation in eine Richtung („Es ist leise, weil es lange währt“ oder „Es währt lange, weil es leise ist“), Äquivalenz der beiden Aussagen
bzw. Implikation in beide Richtungen oder aber ein zufälliges Zusammentreffen festgestellt werden soll, wird nicht weiter erläutert, gleichzeitig fehlt auch ein weiterer Hinweis, worauf sich der Dichter beziehen könnte.
Davon ausgehend, dass der Gedichtband, dessen Titelgedicht dieses ist, 1928 erschienen ist, wäre es auch möglich, dass Ringelnatz dies unter dem Eindruck der Einweihung des Tannenbergdenkmals mit Hindenburgs Rede einer Rechtfertigung des ersten Weltkrieges als einen Akt putativer Notwehr, des Schwazen Freitags, oder der Uraufführung der Dreigroschenoper oder Max Frisxh' Millionenauflage von „Biedermann und die Brandstifter“ geschrieben hat – diese Frage soll aber Ringelnatz-Forschern und Germanisten überlassen werden, meine Expertise ist für ihre Beantwortung bei weitem nicht ausreichen.
Die folgende Strophe, und hier beziehe ich mich auf die Auslegung von Uli Führe auf dem Chorwochenende 2011II auf der Nordhelle, ist seine Abrechnung mit dem Bürgertum, seinem Festhalten an materiellem und körperlichem. „Die Zeit entstellt alle Lebewesen […] wir können nicht bleiben“ bringt deutlich hervor, dass wir dem Fluss der Zeit, dem ewigen Kreislauf von geboren werden, leben, altern und sterben (ja nach individueller Auffassung des Seins als Gattung oder persönlich) unterworfen sind. „Wir können nicht bleiben“ – weder können wir uns am diesseitigen festhalten noch können wir diesseitiges festhalten, ja nicht einmal während der Zeit unseres Lebens können wir uns des einmal erreichten sicher sein. Vermögen kann verloren, gesammelte Steine wieder zerstreut werden, „tempus fugit et nos fugamus in illum“ (die Zeit fließt und wir fließen in ihr) sagt schon ein Sprichwort aus römischer Zeit. Dies kann Ringelnatz, der in seiner Zeit so viel versuchte, sooft scheiterte und sooft wieder von Vorne angefangen hat, feststellen wie kein zweiter.
Man ist geneigt, diese und die vorige Strophe an den in bürgerlicher Perfektheit lebenden Vater zu beziehen, da das Verhältnis der beiden mehr als nur schwierig und gespaltn war, aber vielleicht ist es in Anbetracht der Vielschichtigkeit von Dichter und Gedicht auch zu platt, einen ungelösten Vaterkonflikt als Quelle dieser Inspiration anzunehmen und gleichzeitig den Autoren mit seinem lyrischen ich gleichzusetzen.
Was der Hund, der bellt, nicht lesen und nicht schreiben kann, und der in dieser Strophe auftaucht mit dem ganzen zu tun hat, entzieht sich leider meinder Kenntnis. Wieder lässt Ringelnatz offen, ob es Ursache-Wirkung-Beziehungen zwischen dem Bellen und der mangelnden Alphabetisierung des Hundes gibt, und eigentlich enthält dieser Satz nut triviales. „Ein Hund bellt, er kann nicht lesen, er kann nicht schreiben.“.
Würde man mutig voran dieses Bild auf den Rest der Strophe interpretieren wollen, gäbe es die Möglichkeit zu sagen, Ringelnatz beschriebe halt, was ein Hund so täte und wie er sei. „Der Hund“, könnte man sagen, „ist wie er ist. Er bellt. Er frisst. Er liest nicht, er schreibt nicht.“ Wie auch dieser auf seine Rolle festgelegte „beste Freund des Menschen“ wäre dieser Auffassung nach auch der Mensch in seiner Rolle festgefahren, zwar mit etwas artikulierteren Äußerungen und der Erfindung der Schrift gesegnet unterscheidet beide nicht so viel – alle beide müssen sich den Gesetzen der Zeit unterwerfen, werden „entstellt“ und „können nicht bleiben“.
„Die Löcher sind die Hauptsache an einem Sieb“. Diese Erkenntnis ist so wunderbar trivial, dass man sie leichthin überlesen könnte, zeigt sie aber doch eine Art von Achtsamkeit, einem Blick für das Wesentliche und ein Ausblenden störender Einflüsse, dass sie gleichsam buddhistisch zu nennen ist. Nicht Form, Farbe oder Material machen das Sieb aus, die Löcher sind es. Verschiedenen Berufen ist diese Erkenntnis näher als anderen, so wird jeder, der mit feinkörnigem gemahlenen Substanzen umgeht dies als selbstverständlich bejahen, gibt es doch für jeden Körnungsgrad ein spezielles, genormter Sieb, mit dem Teile, die nicht hinzu gehören, vom Rest abgetrennt werden können, und nur mit zwei unterschiedlichen Sieben ist es Möglich, ein Pulver von exakter Körnung zu bestimmen, sei es als Mehl, Arznei oder Körnung von Schleifpapieren. „Ein Sieb ohne Löcher ist ein Topf“, so hörte man es beim bereits erwähnten Chorwochenende.
Auch hier ist ein freimütiges Hineinfabulieren möglich – ob nun Ringelnatz durch diesen Satz eine Hinlenkung auf das Wesentliche eines Objektes oder darauf, dass das Wesentliche unsichtbar ist (wie es nach ihm wie wohl keiner sonst Antoine de Saint-Exupéry in „Le Petit Prince“ mit den Worten „On ne voit bien qu'avec le coeur. L'essentiel est invisible pour les yeux“ („Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. ) ausdrücken wird) erreichen wollte. Ob er einen witzigen Gegenpol zum ansonsten ersten Gedicht oder eine metaphysische Aussage sei wiederum freimütig der Diskussion von Philosophen und Germanisten überlassen.
Was dem Leser des Gedichtes aber auffällt, ist, dass diese Erkenntnis den betrübten Gemütszustand des Dichters aufzuhellen in der Lage ist. Mit dem einfachen „Ich lache“ beendet er mit diesem Blick auf ein Hilfsmittel aus Haushalt und Industrie seine schwermütige Betrachtung von Abschied, Schuld und fehlender Vergebung und findet zurück ins hier und jetzt, um das Gedicht dann mit einer Reprise auf den Schluss zu schließen: „Ich habe dich so lieb“ beendet endgültig die Schwermut der mittleren Strophen und kommt auf das wesentliche zurück: die Liebe zu dem einen Menschen, auf die ich ja bereits oben eingegangen bin.
|
 |